Depressionen, Fehltage und die Frage der Krankschreibung

Die Zahl der Arbeitsausfälle durch psychische Erkrankungen hat im Jahr 2024 in Deutschland erneut ein Rekordhoch erreicht. Laut DAK-Gesundheitsreport müssen Beschäftigte jährlich durchschnittlich 342 Fehltage pro 100 Personen verkraften, verursacht durch psychische Leiden. Der Hauptgrund sind Depressionen: Diese Diagnose war 2024 der Anlass für 183 Fehltage pro 100 Beschäftigte und konnte damit ihren traurigen Spitzenplatz ausbauen – 2023 lag dieser Wert noch bei 122 Tagen. Besonders betroffen sind große gesetzliche Krankenkassen wie die KKH mit ihren 1,6 Millionen Versicherten: Hier stiegen die Ausfallzeiten durch psychische Erkrankungen im ersten Halbjahr 2023 um 85% gegenüber dem Vorjahr, was einem Anstieg von 164 auf 303 Ausfalltage je 100 Versicherte entspricht. Auch die TK bestätigt diesen Trend und dokumentiert einen auffälligen Anstieg in ihrem eigenen Gesundheitsreport.
Pflege und Kita: Wer trägt die höchste Last?
Nicht alle Berufsgruppen sind von dieser Entwicklung gleichermaßen betroffen. Vor allem Angestellte in Kindertagesstätten oder in der Altenpflege stehen im Zentrum der Krise: Die DAK-Analyse für 2024 weist für den Kita-Bereich 586 psychisch bedingte Fehltage pro 100 Beschäftigte aus, in der Altenpflege sind es 573 Tage. Damit liegen diese Branchen um 71% über dem allgemeinen Durchschnitt. Die Belastung ist vielfach auch mit Stigma und langen Genesungsprozessen verknüpft. Die DAK sieht hier einen dringenden Bedarf an weiterführender Aufklärung und Unterstützung für die mentale Gesundheit, insbesondere für diese Hochrisikogruppen.
Depression führt zu längsten Ausfällen
Nicht allein die Häufigkeit, sondern auch die Dauer der Krankschreibungen unterscheidet sich signifikant: Die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer Erkrankungen liegt laut DAK für 2024 bei rund 33 Tagen pro Fall. Besonders langwierige Ausfälle von 29 bis 42 Tagen nahmen um 14% zu, während sehr kurze Krankschreibungen nur unterproportional anstiegen. Die Problematik zieht sich durch alle Altersgruppen, mit besonderem Schub bei Beschäftigten ab 60 Jahren: Hier stiegen die Fehlzeiten infolge von Depressionen von 169 auf 249 Tage je 100 Beschäftigte. Das verdeutlicht die Bedeutung von Prävention und frühzeitiger Intervention auch im späteren Berufsleben.
Wann ist eine Krankschreibung sinnvoll? Die Leitlinie gibt Antworten
Ob eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei einer depressiven Störung ausgestellt werden sollte, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression betont, dass eine Krankschreibung Patient:innen mit schweren Symptomen entlasten kann, aber nicht für alle Fälle geeignet ist. Besonders bei leichten bis mittleren Depressionen rät sie zu einer genauen Abwägung, da eine längere Arbeitsunfähigkeit auch riskant sein kann – sie kann mitunter den Zustand verschlimmern oder sogar chronisch machen. Die Leitlinie fordert, psychische und arbeitsplatzbezogene Faktoren differenziert zu betrachten, statt reflexartig zu krankschreiben.
Die Leitlinie macht klar: Mit einer AU sollte immer eine adäquate therapeutische Intervention einhergehen. Wird die AU mehrfach verlängert, bedarf es einer intensiveren Behandlung. Die Krankschreibung soll Teil eines ganzheitlichen Ansatzes sein, nicht als eigenständige Maßnahme erfolgen. Besonders betont die Leitlinie das Hamburger Modell der stufenweisen Wiedereingliederung. Hier wird nach einer vollständigen Auszeit ein langsamer Einstieg zurück in den Arbeitsalltag empfohlen, unterstützt durch Teil-AU.
Individuelle Bewertung statt pauschaler Auszeit
Die neuen Empfehlungen führen Behandelnde erstmals systematisch durch die Argumente rund um das Ausstellen einer AU. Gründe gegen eine Krankschreibung sind, dass fehlende Alltagsstruktur, wenig Sozialkontakte und der Wegfall positiver Bestätigung durch Arbeit eine Chronifizierung begünstigen. Ärzt:innen sollten bei der Entscheidung über eine Krankschreibung verschiedene Aspekte individuell prüfen. Wichtig ist vor allem, den Schweregrad der depressiven Symptome und mögliche körperliche Begleiterscheinungen richtig einzuschätzen.
Auch das Ausmaß der Krankheitslast, das Vorhandensein psychotischer Symptome oder zusätzlicher psychiatrischer Erkrankungen wie Angsterkrankungen oder PTBS sowie der Einfluss des sozialen Umfelds müssen berücksichtigt werden. Darüber hinaus gilt es, psychosoziale Faktoren wie die Belastung im Alltag, den Verlust von Tagesstruktur und soziale Isolation einzubeziehen. Schließlich sollten Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit, Risiken wie Wertschätzungsverlust am Arbeitsplatz, mögliche Verstärkung von Vermeidungsverhalten und das Risiko eines Arbeitsplatzverlusts bei wiederholter Krankschreibung nicht außer Acht gelassen werden.
Wann muss eine Auszeit zwingend sein?
In gewissen Fällen ist eine Krankschreibung alternativlos: Bei Patient:innen mit schwer ausgeprägten Symptomen und klaren funktionellen Einschränkungen, die offensichtlich arbeitsunfähig sind, soll keine Abwägung psychosozialer oder arbeitsplatzbezogener Faktoren erfolgen. In diesen Situationen ist die Krankschreibung unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche, strukturierte Behandlung. Bei Patient:innen mit leichten oder mittelgradigen Depressionen muss die Entscheidung für oder gegen eine AU hingegen in enger Abstimmung und anhand individueller Kriterien getroffen werden.
Fazit
Die dramatisch steigende Zahl von Fehltagen aufgrund von Depressionen macht eines klar: Es braucht dringend ein Umdenken im Umgang mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz. Eine Krankschreibung ist nicht automatisch die beste Lösung – vielmehr gilt es, jede Entscheidung sorgfältig und individuell zu treffen. Nur so können Risiken wie Chronifizierung oder sozialer Rückzug vermieden und gleichzeitig Betroffene wirkungsvoll entlastet werden. Arbeitgeber und Ärzt:innen sind gefragt, eng zusammenzuarbeiten, um passende Therapieangebote zu fördern und eine stufenweise Rückkehr zur Arbeit zu ermöglichen. Die mentale Gesundheit ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung – handeln wir jetzt!
Quellen:
Springer Medizin: Auszeit bei Depressionen – eine gute Idee? 2023. https://www.springermedizin.de/auszeit-bei-depressionen---eine-gute-idee-/26554424 (abgerufen am 05.10.2025)
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression. 2022. Registernummer: nvl-005. Version 3.2. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005 (abgerufen am 05.10.2025).
Techniker Krankenkasse (TK): Gesundheitsreport 2023 – Arbeitsunfähigkeiten. 2023. https://www.tk.de/resource/blob/2146912/44b10e23720bf38c1559538949dd1078/gesundheitsreport-au-2023-data.pdf (abgerufen am 05.10.2025).
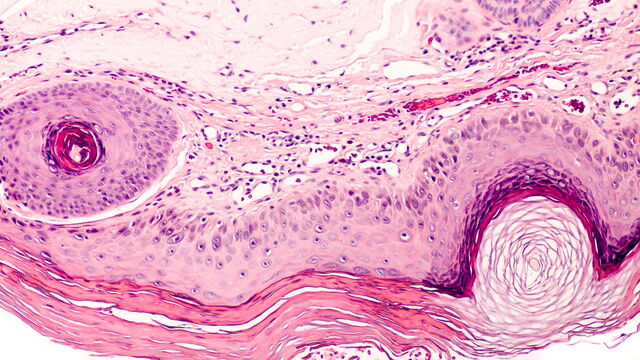
Innovative Ansätze revolutionieren die Behandlung aktinischer Keratosen. Ein europäischer Expert:innenkonsens rückt individuelle Bedürfnisse, Therapiedauer, Adhärenz und moderne Bewertungssysteme in den Fokus einer nachhaltig erfolgreichen Patientenversorgung.

Aktinische Keratose betrifft viele und die photodynamische Tageslichttherapie wirkt, ist aber alles andere als angenehm. Jetzt bringt eine neue dermokosmetische Creme mit Panthenol, Zink, Mangan und präbiotischen Inhaltsstoffen frischen Wind in die Nachsorge! Weniger Rötung, schneller heilende Haut, zufriedene Patient:innen.

Es beginnt mit einem winzigen blinden Fleck am Rand des Gesichtsfelds. Unbemerkt. Schmerzlos. Jahre später kann daraus ein Tunnel werden – und irgendwann Dunkelheit. Der Grüne Star, medizinisch Glaukom genannt, ist ein Meister der Tarnung. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verlieren jedes Jahr Hunderttausende Menschen deshalb ihr Augenlicht, obwohl sich die Erkrankung mit moderner Medizin oft stoppen ließe. Doch warum wird das Glaukom so spät erkannt, und wie lässt sich die Zeitbombe entschärfen?

