Präzision statt Zufall: Wie strukturierte Dermatoskopie-Ausbildung die Hautkrebsdiagnostik revolutioniert

Akne ist weit mehr als nur ein kosmetisches Problem: Für viele Betroffene bedeutet sie eine erhebliche psychische Belastung, die bis hin zu sozialer Isolation führen kann. Studien zeigen, dass etwa 50% bis 95% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren während der Pubertät Akne entwickeln. Doch auch Erwachsene, vor allem Frauen, sind zunehmend betroffen. Zudem sind die psychischen Folgen von Akne erheblich. Viele Betroffene erleben Scham, eine verminderte Lebensqualität und sozialen Rückzug. Beispielsweise berichtet Jana, 24 Jahre, die seit ihrer Jugend unter Akne leidet, dass der sichtbare Hautzustand ihr Selbstbewusstsein stark beeinträchtigte und sie erst durch eine gezielte Behandlung wieder Lebensqualität zurückgewann. Die hohe Verbreitung und die psychischen Folgen verdeutlichen, dass Akne als ernstzunehmende Erkrankung verstanden und angemessen behandelt werden muss.
Die Ursachen im Fokus: Von Genen bis Stress
Die Entstehung von Akne beruht auf dem Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren. Zunächst spielt die genetische Veranlagung eine wichtige Rolle: Immer wieder zeigt sich, dass Akne familiär gehäuft auftritt, was darauf hindeutet, dass bestimmte Gene die Empfindlichkeit der Haut sowie die Neigung zu Akne erhöhen können. Darüber hinaus sind hormonelle Einflüsse entscheidend für das Hautbild. So fördern etwa das Sexualhormon Testosteron und der insulinähnliche Wachstumsfaktor IGF-1 die Verhornung der Hautzellen und regen die Talgdrüsen zur vermehrten Produktion von Talg an. Diese Überproduktion führt häufig zur Verstopfung der Poren und begünstigt somit die Entstehung von Pickeln.
Auch die Ernährung wirkt sich auf die Akne aus: Eine Ernährung mit hohem Anteil an Kohlenhydraten und Milchprodukten kann die Hautprobleme verschlimmern, da solche Lebensmittel Signalwege aktivieren, die sowohl die Talgproduktion als auch Entzündungen verstärken. Typische Beispiele hierfür sind Speisen wie Pizza, Pommes und Milchprodukte. Schließlich trägt auch Stress dazu bei, die Aknesymptome zu verschärfen. Psychische Belastungen fördern durch neurochemische Prozesse, unter anderem die Ausschüttung von Neuropeptiden, eine Verschlechterung des Hautbildes. Insgesamt zeigen diese verschiedenen Ursachen, wie komplex die Entstehung von Akne ist.
Von der Verhornung bis zum Pickel: Der biologische Prozess hinter Akne
Im Kern entsteht Akne durch eine übermäßige Produktion von Talg in den Hautdrüsen kombiniert mit einer verstärkten Verhornung der Haarfollikel. Diese Veränderungen bewirken, dass die Öffnungen der Talgdrüsen verstopfen und Mitesser sowie Entzündungen (Pickel) entstehen. Ein erhöhtes Niveau der Hormone Testosteron und IGF-1 fördert diesen Vorgang. Hinzu kommt ein erhöhtes Ansprechen der Haut auf Entzündungsreize, die durch Ernährung oder Stress ausgelöst werden können. Dies erklärt, warum Akne multifaktoriell bedingt ist und unterschiedliche Erscheinungsbilder aufweist.
Therapeutische Ansätze: Von lokal bis systemisch – individuell wirksam behandeln
Die Behandlung von Akne richtet sich stets nach dem Ausmaß der Erkrankung und der individuellen Situation der Betroffenen. Bei leichten Formen der Akne reicht oft eine lokale Therapie aus, bei der Wirkstoffe wie Retinoide oder Azelainsäure direkt auf die Haut aufgetragen werden. Diese Substanzen unterstützen die Erneuerung der Hautzellen und verhindern eine übermäßige Verhornung, wodurch die Entstehung von Mitessern und Pickeln gehemmt wird. Bei mittelschweren Akneformen empfiehlt sich häufig eine Kombinationstherapie, bei der Retinoide zusammen mit Benzoylperoxid oder Antibiotika eingesetzt werden. Diese Kombination bekämpft sowohl Entzündungen als auch die auslösenden Bakterien effektiv. Speziell bei Frauen, die an hormonell bedingter Akne leiden, kann eine antiandrogene Hormonbehandlung sinnvoll sein. Diese Therapie zielt darauf ab, die Wirkung männlicher Sexualhormone zu reduzieren und so die Hautsymptome zu verbessern.
Bei schweren Akneverläufen ist meist eine systemische Behandlung erforderlich, bei der Antibiotika oder das Medikament Isotretinoin zum Einsatz kommen. Letzteres gilt als besonders wirkungsvoll, muss jedoch wegen möglicher Nebenwirkungen engmaschig überwacht werden und darf nicht während einer Schwangerschaft angewendet werden. Zusätzlich wird häufig eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten empfohlen. Durch die Reduktion von Milchprodukten sowie stark kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln sollen hormonelle Einflüsse auf die Talgproduktion verringert werden, um das Hautbild nachhaltig zu verbessern.
Diese Empfehlungen orientieren sich an den aktuellen Leitlinien zur Aknetherapie (AWMF-Registernummer 013-017, „Therapie der Akne“).
Fazit
Akne ist eine komplexe Erkrankung, deren Ursachen von genetischen Prädispositionen über hormonelle Schwankungen bis hin zu Ernährungs- und Stressfaktoren reichen. Die vielfältigen Ausprägungen erfordern individuell angepasste Therapieansätze, die sowohl physische als auch psychische Aspekte berücksichtigen. Die Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und das frühe Einbeziehen dermatologischer und psychologischer Fachkompetenzen ermöglichen eine maßgeschneiderte Behandlung und verbessern damit Lebensqualität und Hautgesundheit der Betroffenen langfristig.
Quellen:
Schuh, S. et al. "Implementierung eines Dermatoskopie-Curriculums in der Facharztausbildung am Universitätsklinikum Augsburg." Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2023, https://doi.org/10.1111/ddg.15115_g (abgerufen am 14.07.2025).
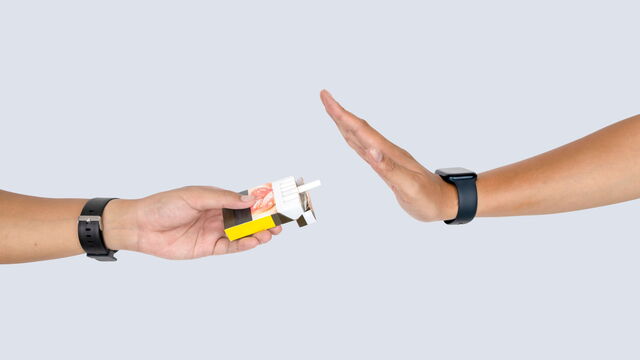
rTMS könnte die Suchtmedizin revolutionieren: Eine große Studie zeigt, dass tiefe Hirnstimulation bei Nikotinabhängigkeit wirkt – besser als Placebo. In Kombination mit Verhaltenstherapie steigert sie die Abstinenzrate deutlich. Erste Kliniken in Deutschland testen bereits das Verfahren.

Die atopische Dermatitis ist weit mehr als nur trockene, juckende Haut – sie beeinträchtigt die Lebensqualität. Insbesondere die Überwucherung durch Staphylococcus aureus verschärft Entzündungen und Barriereschäden. Neueste Forschung zeigt: Mikrobiombasierte und metabolische Therapien könnten die Zukunft der AD-Behandlung sein.


