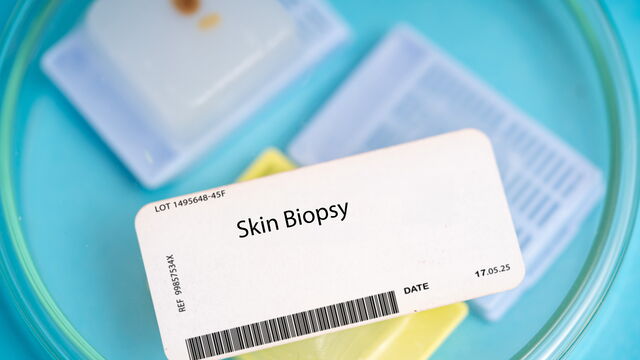Hautmikrobiom und atopische Dermatitis: Therapie jenseits der Immunsuppression

Die atopische Dermatitis (AD) ist mehr als nur trockene, juckende Haut. Sie betrifft weltweit rund ein Fünftel aller Kinder und ein Zehntel der Erwachsenen und beeinträchtigt massiv die Lebensqualität der Betroffenen. Nicht selten tritt AD im Verbund mit anderen atopischen Erkrankungen wie Asthma oder allergischer Rhinitis auf. Die Ursachen sind komplex: Genetische Veranlagung, eine geschwächte Hautbarriere und Umweltallergene spielen eine zentrale Rolle. Besonders bei Kindern zeigt sich die Erkrankung häufig früh, mit Hautveränderungen im Gesicht und auf der Kopfhaut. Die sichtbaren Symptome verursachen nicht nur körperliches Unbehagen, sondern belasten auch die psychische Gesundheit stark.
Mikrobiom als Schlüssel: Wie Bakterien die Haut beeinflussen
Neueste Studien revolutionieren unser Verständnis der AD, indem sie das Hautmikrobiom als zentrale Krankheitsursache identifizieren. Besonders das Bakterium Staphylococcus aureus spielt eine fatale Rolle: Es überwuchert bei AD-Patient:innen die Haut, fördert Entzündungen und schädigt die Hautbarriere. Die gesunde Haut ist ein Ökosystem, dominiert von nützlichen Mikroorganismen wie Cutibacterium, Corynebacterium und Staphylococcus epidermidis, die die Hautabwehr stärken. Bei AD kippt dieses Gleichgewicht dramatisch – eine sogenannte Dysbiose entsteht. Das Mikrobiom wird immer mehr zum kontrovers diskutierten Therapieansatz, doch noch sind viele Fragen offen.
Warum das Mikrobiom nicht nur Bakterien bedeutet
Das Hautmikrobiom ist viel mehr als Bakterien: Viren und Pilze wie Malassezia beeinflussen ebenfalls die Hautgesundheit. Die mikrobielle Vielfalt auf der Haut variiert je nach Alter, Körperregion und Umwelt, und schon bei der Geburt wird der Grundstein gelegt – ob vaginal oder per Kaiserschnitt geboren wurde, bestimmt maßgeblich die erste mikrobielle Besiedelung. Diese frühe Kolonisierung prägt das Immunsystem und die spätere Anfälligkeit für Erkrankungen wie AD. Gerade in der Pubertät stabilisiert sich die Hautmikrobiota durch Hormone und Talgproduktion, was die Haut schützt – außer bei genetischer oder immunologischer Schwäche.
Dysbiose und Immunversagen: Der Teufelskreis bei AD
Das Ungleichgewicht der Hautmikrobiota bei AD ist ein Teufelskreis: S. aureus verdrängt schützende Bakterien, zerstört die Hautbarriere und fördert Entzündungen durch toxische Substanzen. Gleichzeitig ist die Immunantwort fehlgeleitet: Die Produktion antimikrobieller Peptide sinkt, was die Dysbiose weiter verschärft. Mutationen im Filaggrin-Gen verschlechtern die Barriere zusätzlich und erleichtern das Eindringen von Allergenen und Erregern. Das Ergebnis: Chronische Entzündung, starker Juckreiz, häufige Infektionen. Diese komplexen Zusammenhänge werden zunehmend in der Medizin diskutiert, weil sie das herkömmliche Verständnis von AD als reine Entzündungserkrankung infrage stellen.
Metabolite: Die unterschätzten Helfer der Haut
Neben dem Mikrobiom rückt die Rolle von Stoffwechselprodukten ins Rampenlicht. Kurzkettige Fettsäuren (SCFAs) wie Acetat oder Butyrat sind essenziell, um den leicht sauren pH-Wert der Haut zu erhalten, der krankheitserregende Keime hemmt. Bei AD sind diese SCFAs oft drastisch vermindert, was die Hautbarriere schwächt. Auch langkettige Fettsäuren (LCFAs), die vor allem als Ceramide die Lipidbarriere stärken, sind reduziert. Diese biochemischen Veränderungen fördern Entzündungen und machen die Haut für weitere Schäden anfällig. Aminosäure- und Indolderivate, die über spezielle Rezeptoren wie den Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR) wirken, spielen eine weitere Schlüsselrolle bei der Immunregulation und Barrierefunktion. Hier steckt enormes Potenzial für neue Therapieansätze, etwa durch gezielte Aktivierung des AhR mit Substanzen wie Tapinarof.
Revolutionäre Therapieansätze: Mikrobiom und Metabolom im Fokus
Konventionelle Therapien mit Immunsuppressiva greifen bei AD oft zu kurz – sie bekämpfen Symptome, aber nicht die Ursachen. Mikrobiombasierte Therapien zielen darauf ab, die natürliche Hautflora wiederherzustellen: Die topische Applikation nützlicher Bakterien wie Staphylococcus hominis oder Roseomonas mucosa kann die Besiedelung durch S. aureus reduzieren und die Hautbarriere stärken. Erste klinische Daten sind vielversprechend, aber die individuelle Variabilität bleibt eine Herausforderung. Probiotika, die konjugierte Linolsäure (CLA) produzieren, zeigen entzündungshemmende Effekte, doch menschliche Studien fehlen noch weitgehend. Auch metabolomische Analysen bieten einen Weg zu personalisierten Therapien, die Stoffwechselstörungen gezielt ausgleichen und so das Immunsystem und die Hautbarriere unterstützen.
Was Ärzt:innen wissen sollten
Für die tägliche Praxis bedeutet dies: AD ist nicht nur eine Frage der Entzündungshemmung, sondern ein multifaktorielles Problem mit mikrobiellen und metabolischen Dimensionen. Therapeutische Strategien müssen über die klassischen Behandlungsansätze hinausgehen und auch die Hautmikrobiota gezielt berücksichtigen. Das Ansprechen auf neue, mikrobielle und metabolische Therapien ist individuell verschieden – hier sind Ärzt:innen gefragt, um personalisierte Konzepte zu entwickeln und kritisch zu begleiten. Trotz noch offener Fragen ist der Trend klar: Mikrobiom- und metabolomische Therapien werden die Zukunft der AD-Behandlung mitgestalten.
Quellen:
Kim et al. (2025): Skin Microbiome Dynamics in Atopic Dermatitis: Understanding Host-Microbiome Interactions. Allergy, Asthma & Immunology Research, DOI: 10.4168/aair.2025.17.2.165

Virale Hautinfektionen wie Warzen oder Herpes mit therapieresistenten oder rezidivierenden Verläufen bereiten in der Praxis häufig Kopfzerbrechen. Doch die Kombination aus Licht, Photosensibilisator und Sauerstoff bietet den Viren Paroli: Die PDT zerstört infizierte Zellen effektiv – und stimuliert gleichzeitig das Immunsystem.

Der Klimawandel führt zu einer drastischen Zunahme von UV-Strahlung und damit zu mehr Hautkrebs, insbesondere bei außen Beschäftigten. Prävention und innovative Therapieansätze sind jetzt unverzichtbar, um Gesundheit und Lebensqualität zu sichern.