Melanom: Wo Immuntherapie und Künstliche Intelligenz aufeinandertreffen
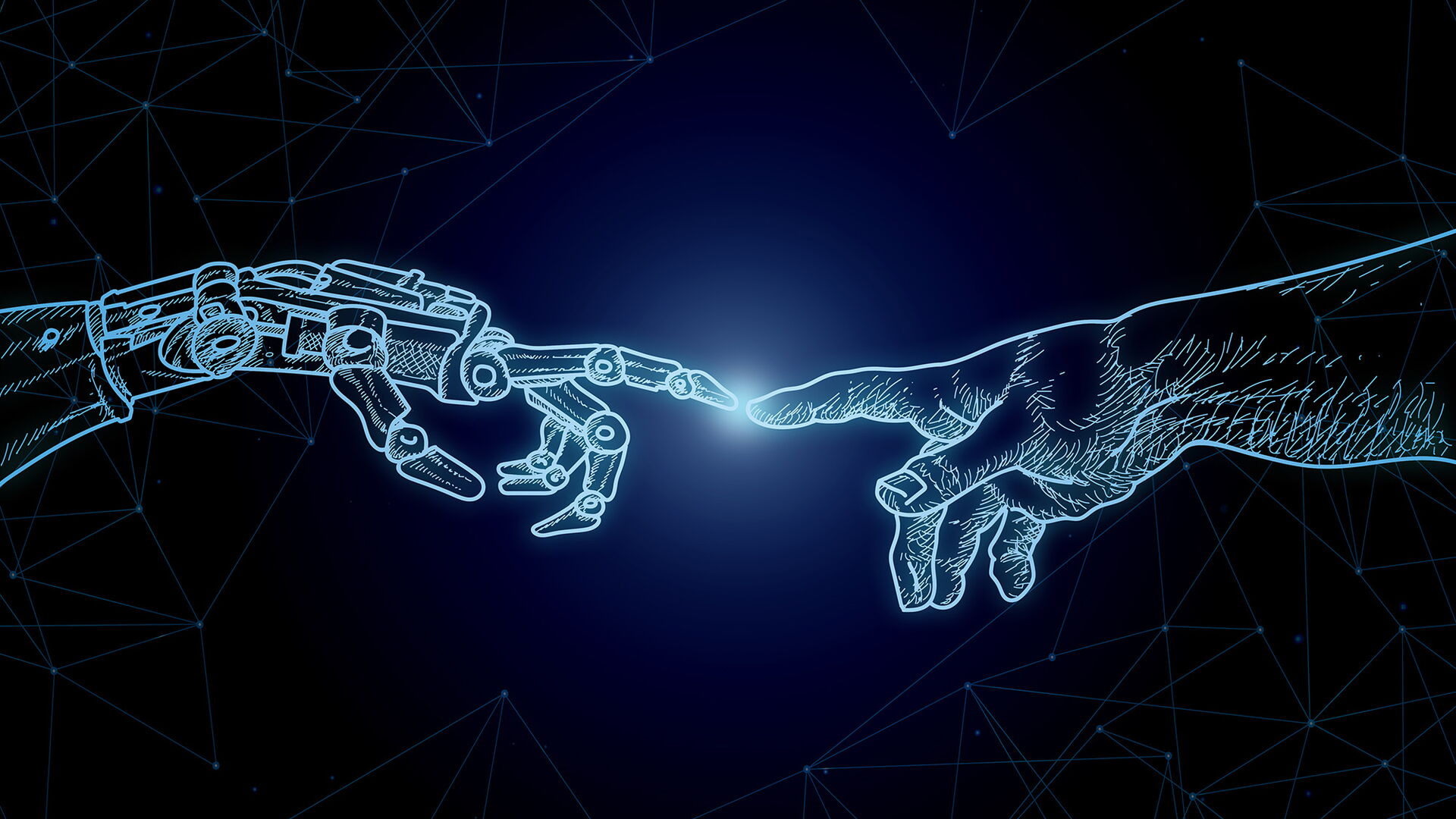
Das maligne Melanom zählt zu den aggressivsten Hautkrebsformen und obwohl die Sterblichkeit in Ländern wie den USA seit Jahren rückläufig ist, bleibt es für viele Patient:innen eine tödliche Diagnose. Dank der Einführung von Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICIs) hat sich die Prognose für viele jedoch deutlich verbessert. Die Wirkstoffe haben das therapeutische Spektrum erweitert und das Überleben in späten Krankheitsstadien verlängert. ICIs blockieren immunhemmende Signalwege, die Tumorzellen zur Tarnung vor dem Immunsystem nutzen. Vor allem drei Wirkstoffklassen kommen dabei zum Einsatz: PD-1-Inhibitoren (z. B. Nivolumab, Pembrolizumab), PD-L1-Inhibitoren (z. B. Atezolizumab, Avelumab) und CTLA-4-Inhibitoren (z. B. Ipilimumab). Besonders effektiv, aber auch risikobehaftet, zeigt sich die Kombinationstherapie aus PD-1/PD-L1- und CTLA-4-Blockade.
Viel Wirkung, viel Nebenwirkung
So erfolgversprechend ICIs auch sind: Nicht alle Patient:innen sprechen darauf an. Und selbst wer profitiert, zahlt mitunter einen hohen Preis. Immunvermittelte Nebenwirkungen wie Hautausschläge, Fatigue, Durchfall und sogar kardiovaskuläre Komplikationen wie Myokarditis treten häufig auf. Zudem entwickeln manche Patient:innen Resistenzen – ein Problem, das bisher nur schwer vorhersehbar war. Genau hier kommt die Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel. Sie verspricht, den Durchbruch in der personalisierten Immuntherapie zu liefern. Erste Studien zeigen, dass KI nicht nur helfen kann, das Ansprechen auf ICIs vorherzusagen, sondern auch Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen.
KI trifft Tumorbiologie: Von der Theorie zur Praxis
Maschinelles Lernen und Deep-Learning-Verfahren analysieren Bilddaten, Genexpressionsmuster oder Zytokin-Profile, um Muster zu erkennen, die für den Therapieerfolg entscheidend sind. Ein Beispiel: Eine Forschungsgruppe entwickelte ein Modell zur Vorhersage der Nivolumab-Clearance anhand von Zytokin-Signaturen – mit direktem Einfluss auf die Dosierungsstrategie. Auch auf zellulärer Ebene liefert KI neue Erkenntnisse: Deep Convolutional Neural Networks (DCNNs) helfen bei der Analyse des Tumormikromilieus und ermöglichen eine differenziertere Beurteilung von Tumor-Immun-Interaktionen. Die PD-L1-Expression lässt sich damit objektiver bestimmen – mit einer Übereinstimmung von bis zu 97 % im Vergleich zur manuellen Pathologiebewertung.
Wenn der Computer Nebenwirkungen vorhersagt
Auch bei der Vorhersage immunvermittelter Nebenwirkungen (immune-related adverse events, irAEs) zeigt KI ihr Potenzial. Auf Basis elektronischer Gesundheitsakten lassen sich Modelle trainieren, die sowohl irAEs als auch das Überleben nach einem Jahr zuverlässig prognostizieren. Das eröffnet neue Möglichkeiten im Nebenwirkungsmanagement und in der Patientenselektion. Selbst KI-Chatbots wie ChatGPT wurden in Studien bereits auf ihr Potenzial zur Beantwortung medizinischer Fragen rund um irAEs getestet – mit vielversprechenden, aber noch nicht klinisch validierten Ergebnissen.
Deep Learning: Der neue Blick aufs Tumorgewebe
KI-basierte Bildanalyse geht weit über herkömmliche Pathologie hinaus. DCNNs ermöglichen die präzise Identifikation von Tumorarealen, Lymphozyten und Bindegewebe. Besonders spannend: Die elektronische TIL-Skala (eTILs), die tumorinfiltrierende Lymphozyten quantifiziert, erwies sich in Studien als prädiktiver Marker für das Ansprechen auf Anti-PD-1-Therapien und war mit besserem Überleben assoziiert. Radiomics, also die KI-gestützte Auswertung bildgebender Verfahren, ergänzt diese Analyse um wichtige Körperkompositionsdaten. Eine reduzierte Skelettmuskelmasse zum Beispiel korreliert signifikant mit schlechteren Therapieergebnissen. Kombinierte Modelle aus CT-Bilddaten und Biomarkern wie LDH könnten also bald eine zentrale Rolle in der Therapieentscheidung spielen.
KI allein reicht nicht – aber sie zeigt, wo’s langgeht
Trotz aller Euphorie bleibt die Implementierung in der klinischen Praxis herausfordernd: Datenqualität, Standardisierung, Interpretierbarkeit der Modelle und regulatorische Hürden sind nur einige Stolpersteine. Auch Deep-Learning-Modelle, die auf einzelne CT-Bilder zurückgreifen, liefern bislang noch keine ausreichend zuverlässigen Ergebnisse. KI wird nicht von heute auf morgen zum Allheilmittel. Aber sie entwickelt sich zu einem mächtigen Werkzeug, um Therapien zu individualisieren, Nebenwirkungen zu kontrollieren und das Überleben der Patient:innen zu verbessern. Wer heute schon versteht, wie diese Systeme funktionieren, wird morgen bessere Entscheidungen am Point of Care treffen.
Quellen:
Saleem et al. (2025): Optimizing Immunotherapy: The Synergy of Immune Checkpoint Inhibitors with Artificial Intelligence in Melanoma Treatment. Biomolecules, DOI: 10.3390/biom15040589.

Nicht alle reagieren gleich auf eine Strahlentherapie – doch wer bekommt schwere Nebenwirkungen? Eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigt, welche Biomarker helfen könnten, das Risiko besser einzuschätzen. Aber: Methodische Schwächen und mangelnde Replikation bremsen bisher den klinischen Einsatz.

Chronisches Hand- oder Fußekzem? Eine neue Studie zeigt, dass eine Kombination aus Bildungsprogramm und App positive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patient:innen hat. Erfahren Sie mehr über die überraschenden Studienergebnisse und wie digitale Tools die Langzeitbetreuung revolutionieren könnten.

Seit seiner Erfindung im Jahr 1924 hat das Elektroenzephalogramm (EEG) die Neurowissenschaft revolutioniert. Heute ist es ein Hightech-Instrument, das mit künstlicher Intelligenz (KI), mobiler Überwachung und präziser Signalverarbeitung die Grenzen der Medizin erweitert. 100 Jahre später blicken wir auf die Evolution des EEGs und seine bahnbrechenden Anwendungen in der modernen Therapie.

