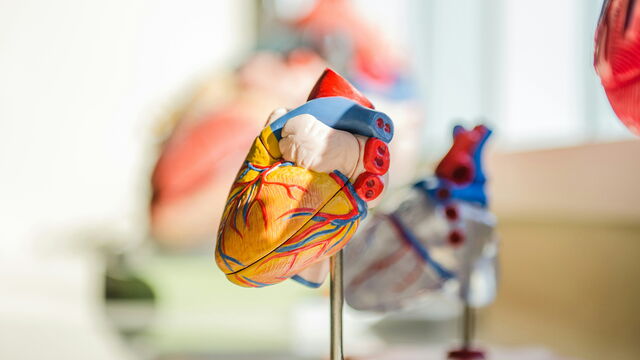Wenn Nebenwirkungen zum Vorteil werden – Antidepressiva neu gedacht

Eine große Meta-Analyse (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7) mit 522 Studien und 116.477 Patient:innen brachte es deutlich ans Licht: Alle untersuchten Antidepressiva waren einer Placebobehandlung in der Therapie akuter depressiver Episoden überlegen. Überraschend gering fielen jedoch die direkten Unterschiede zwischen den Wirkstoffen in ihrer Wirksamkeit aus. Damit rückt ein anderer Faktor in den Vordergrund: das Nebenwirkungsprofil. Denn hier zeigen sich klare Unterschiede – und genau diese können in der klinischen Praxis entscheidend sein.
Sedierend oder aktivierend – der erste Weichensteller
Die Sicht auf Nebenwirkungen sollte differenziert erfolgen: Manche Effekte sind hinderlich, andere können durchaus genutzt werden. Ein klassisches Beispiel stellt die Antriebssteigerung dar, die für Patient:innen mit starker Antriebsminderung hilfreich sein kann. Ebenso hat eine Schmerzdistanzierung in Einzelfällen Vorteile, etwa durch Wirkstoffe wie Duloxetin oder Venlafaxin.
Ein häufiges Problem bei Depressionen sind Schlafstörungen. Hier können Präparate mit sedierenden Eigenschaften eine wertvolle Option sein. Beispiele sind Mirtazapin, Trimipramin oder Amitriptylin. Während Antidepressiva mit schlaffördernden Eigenschaften hier als geeignete Wahl gelten, warnt die S3-Leitlinie vor einem unreflektierten Einsatz von Benzodiazepinen und Z-Substanzen.
Bei leichten Depressionen sollen sie nicht genutzt werden, bei mittelschweren Episoden nur ausnahmsweise und ergänzend, wenn eine akute Notwendigkeit besteht. Für spezielle Indikationen wie Komorbiditäten oder Notfälle gelten gesonderte Regeln.
Praktische Empfehlungen für den Einstieg
Laut Prof. Hans-Peter Volz, Neurologe und Psychiater aus Würzburg, ist es sinnvoll, für die Basistherapie je ein bewährtes Präparat aus der sedierenden und der nicht-sedierenden Gruppe parat zu haben. Zu den häufig gewählten Startsubstanzen gehören Mirtazapin (sedierend) und Escitalopram (nicht sedierend).
Gleichwohl sprechen rund ein Drittel der Patient:innen nicht auf die initiale Therapie an. In diesem Fall muss die Behandlung überprüft werden – sei es durch einen Wirkstoffwechsel oder durch ergänzende Verfahren wie Psychotherapie.
Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen
Gewichtszunahme: Besonders unter Mirtazapin und Amitriptylin kann es zu deutlicher Gewichtszunahme kommen. Bei Patient:innen mit Übergewicht oder Diabetes mellitus ist das problematisch.
Sexuelle Dysfunktion: Vor allem SSRI, die ansonsten als gut verträglich gelten, verursachen häufig sexuelle Funktionsstörungen – ein häufiger Grund für Therapieabbrüche.
Kardiale Effekte: Vorsicht ist geboten bei trizyklischen Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Clomipramin) und auch bei Citalopram und Escitalopram, da sie zu QT-Zeit-Verlängerungen führen können.
Anticholinerge Nebenwirkungen: Symptome wie Mundtrockenheit, Obstipation oder verminderter Tränenfluss sind besonders bei Trizyklika häufig. Vor allem ältere Patient:innen sollten sorgfältig auf diese Aspekte überwacht werden.
Ein weiteres Schlüsselelement ist die Arzneimittelsicherheit. Antidepressiva werden über unterschiedliche Cytochrom-P450-Isoenzyme abgebaut, teils im Darm, teils in der Leber. Viele Präparate beeinflussen die Aktivität dieser Enzyme und können dadurch den Plasmaspiegel anderer Medikamente verändern – ein entscheidender Punkt bei Patient:innen mit komplexer Medikation.
Ein Beispiel aus der Praxis:
Herr K., 58 Jahre, stellte sich in der psychiatrischen Ambulanz mit einer mittelgradigen depressiven Episode vor. Besonders belastend schilderte er Einschlafstörungen und häufiges nächtliches Erwachen. Da gleichzeitig eine Adipositas mit Prädiabetes bestand, musste bei der Antidepressiva-Auswahl eine Gewichtszunahme unbedingt vermieden werden. In der Abwägung entschied sich das Behandlungsteam zunächst für Escitalopram – als wirksam und stoffwechselneutral bekannt. Schon nach wenigen Wochen zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Stimmung, die Schlafprobleme blieben jedoch bestehen.
Ein Präparatewechsel auf Mirtazapin wurde erwogen, jedoch aufgrund des Risikos weiterer Gewichtszunahme verworfen. Stattdessen erhielt Herr K. als Zusatzmedikation niedrig dosiertes Trimipramin zur Nacht, das sedierend wirkt, zugleich aber in der Dosierung keinen relevanten Einfluss auf Gewicht oder Stimmung hatte. Im Verlauf besserte sich die Schlafqualität spürbar, wodurch sich in der Gesamtsymptomatik deutliche Fortschritte zeigten. Der Fall unterstreicht, dass Nebenwirkungen – in diesem Fall die sedierende Wirkung eines Antidepressivums – gezielt genutzt werden können, wenn sie in das individuelle Beschwerdebild passen, ohne dabei neue Risiken zu schaffen.
Fazit: Therapieentscheidung mit Augenmaß
Die Wahl des richtigen Antidepressivums entscheidet sich nicht allein über dessen Wirksamkeit – die ist bei allen gängigen Präparaten ähnlich. Vielmehr bestimmen Nebenwirkungen, individuelle Symptomprofile, Vorerkrankungen und persönliche Präferenzen den Behandlungserfolg. Ein sorgfältiges Abwägen dieser Faktoren ist daher die Grundlage, um eine langfristig effektive und gut verträgliche Therapie sicherzustellen.
Auch interessant:
Gewichtszunahme durch Antidepressiva?
(https://www.springermedizin.de/gewichtszunahme-durch-antidepressiva-/50195192)
Quellen:
Hiller, G.; Voderholzer, U. (2012): Nebenwirkungen von Antidepressiva. Psychiatrie und Psychotherapie up2date. 10.1055/s-0031-1298962
Holt, R.I.G. et al. (2014): Diabetes and depression. Curr Diab Rep. https://doi.org/10.1007/s11892-014-0491-3
Cipriani, A et al. (2018): Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7
Springer Medizin: Antidepressiva: Nebenwirkungen erwünscht? 2024. https://www.springermedizin.de/antidepressiva--nebenwirkungen-erwuenscht-/26940812 (abgerufen am 02.10.2025).
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression. 2022. Registernummer: nvl-005. Version 3.2. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005 (abgerufen am 30.09.2025).

Beim Absetzen von Antidepressiva treten häufig Absetzsymptome auf, die behandelbar sind. Wir erklären Risiken, Unterschiede zu Abhängigkeit, typische Symptome und wie die Medikation sicher reduziert wird.

Eine umfassende Cochrane-Analyse bestätigt: Johanniskrautextrakte können bei leichten bis mittelschweren Depressionen genauso wirksam sein wie synthetische Antidepressiva, überzeugen gegenüber Placebo und zeigen bessere Verträglichkeit.