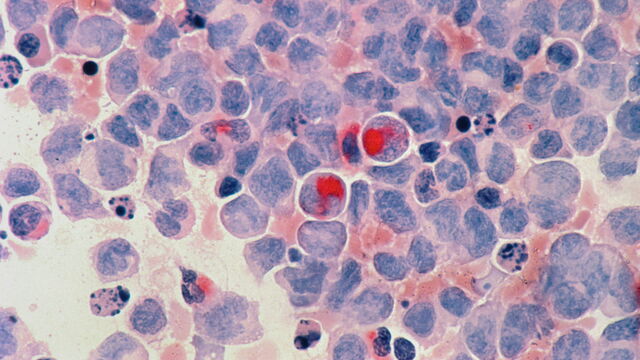Unerkannte Krise: Wenn Männer ihre Depression verstecken

Depression gilt als eine der häufigsten psychischen Erkrankungen und betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Doch die Art und Weise, wie Männer psychische Belastungen erleben und ausdrücken, unterscheidet sich oft grundlegend. Während depressive Frauen häufig von innerer Leere, Traurigkeit und Antriebslosigkeit berichten, treten bei Männern nicht selten Wut, Reizbarkeit und Rückzugsverhalten in den Vordergrund. Genau diese Unterschiede führen dazu, dass Depressionen bei Männern zu selten erkannt und behandelt werden – mit teils gravierenden Folgen.
Unsichtbare Leiden: Wie Männer ihre Depression maskieren
Ein Fallbeispiel bringt die Herausforderung auf den Punkt: Herr S., 48 Jahre alt, gilt im Berufsleben als belastbar, zeitweise aber auch aufbrausend. Zu Hause wird er zunehmend gereizt, zieht sich von seiner Familie zurück, verweigert Gespräche und reagiert bei kleineren Konflikten mit Unverständnis und Wut. Erst nach längerer Zeit und auf Drängen seiner Partnerin sucht er professionelle Hilfe – eine typische Situation.
Viele Männer kämpfen bei einer Depression nicht mit der klassischen Antriebslosigkeit, wie sie häufig mit der Erkrankung assoziiert wird. Stattdessen dominieren Frustration, übersteigerte Reaktionen und impulsive Verhaltensweisen. Das Leugnen psychischer Probleme ist bei Männern besonders ausgeprägt: Betroffene nehmen ihre Symptome nicht ernst oder verharmlosen sie als „schlechte Phase“, die sie allein überwinden sollten.
Die Fakten: Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache
Expert:innen schätzen, dass bis zu 5,6 Millionen Männer in Deutschland unter einer Depression leiden. Die Dunkelziffer ist erheblich, da die Symptome häufig nicht erkannt oder falsch gedeutet werden. Auffällig ist: Die Suizidrate bei Männern liegt rund dreimal höher als bei Frauen – ein Umstand, der die dringende Notwendigkeit einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung unterstreicht.
Doch trotz dieser alarmierenden Zahlen bleibt ein Großteil der Depressionserkrankungen bei Männern unerkannt, wie Prof. Dr. Anna Maria Möller-Leimkühler von der Ludwig-Maximilians-Universität in München präzisiert: „Eine Depression wird bei Männern im Vergleich zu Frauen etwa nur halb so häufig diagnostiziert. Das bedeutet aber nicht, dass Männer ein geringeres Risiko hätten, an einer Depression zu erkranken. Wir haben es hier mit einer systematischen Unterdiagnostizierung zu tun.“
Zugleich wenden sich Männer seltener an Fachpersonen: In psychiatrischen und psychotherapeutischen Praxen ist nur jede dritte Patientin bzw. jeder dritte Patient männlich. Dies liegt nicht nur an der geringeren Bereitschaft, seelische Erkrankungen zuzulassen, sondern auch an atypischen Beschwerden – darunter körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Verspannungen und Schlafstörungen, die den psychischen Ursprung verschleiern können.
Zwischen Stigma und Gesundheitsbewusstsein: Gesellschaftliche Herausforderungen
Die gesellschaftliche Erwartung an Männer, stark und belastbar zu sein, verhindert allzu oft einen offenen Umgang mit psychischen Leiden. Betroffene fürchten, schwach oder „unmännlich“ zu erscheinen. Der enorme Druck, den eigenen Erwartungen – und denen der Gesellschaft – zu entsprechen, trägt zur Abwärtsspirale bei. Umso wichtiger ist es, Klischees und Tabus aufzubrechen und das Bewusstsein für die Vielfalt depressiver Symptome zu schärfen.
Auch bei der Auswahl eines Antidepressivums spielt die Nebenwirkung „sexuelle Dysfunktion“ eine besondere Rolle. Gerade Männer beenden die Therapie aus Angst vor Libido- und Erektionsstörungen häufiger vorzeitig. Fachpersonal sollte daher offen über potenzielle Nebenwirkungen sprechen und Patient:innen eng in Entscheidungsprozesse einbinden.
Fazit: Depression bei Männern – ein plakatives Tabu
Depressionen bei Männern werden allzu oft übersehen. Nur eine klare Sensibilisierung für die atypischen Symptome und die Besonderheiten männlicher Lebenswelten kann die Versorgungslücke schließen. Ein Umdenken ist dringend nötig – in der Gesellschaft, in der Diagnostik und vor allem in unseren Köpfen.
Quellen:
SpringerMedizin: Aggressiv statt antriebslos – so erkennen Sie Depressionen bei Männern. 29.01.2024. https://www.springermedizin.de/so-erkennen-sie-depressionen-bei-maennern/50127428 (abgerufen am 07.08.2025).
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression. 2022. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005 (abgerufen am 07.08.2025).
Planet Wissen: Depressionen bei Männern – Interview. 2022. https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/depression_wenn_die_seele_trauer_traegt/interview-depressionen-bei-maennern-100.html (abgerufen am 07.08.2025).
DAK-Gesundheit: Psychreport 2024. https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/psychreport-2024_57364 (abgerufen am 07.08.2025).
Mayo Clinic: Male depression: Understanding the issues. 2024. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/male-depression/art-20046216 (abgerufen am 07.08.2025).

Klimawandel, Umweltstress und psychische Belastungen: Wie planetare Veränderungen Haut und Seele beeinflussen – und warum ein neues medizinisches Denken jetzt dringend gebraucht wird.

Eine sorgfältige Fußpflege ist für Menschen mit Diabetes essenziell, um das schwere diabetische Fußsyndrom und damit verbundene Amputationen zu vermeiden. Prävention beginnt bei einfachen Maßnahmen.