Haut unter Klimastress: Wenn Wetterbedingungen zur Herausforderung werden

Unsere Haut ist weit mehr als nur eine äußere Hülle – sie fungiert als hochsensibles Sinnesorgan und reagiert unmittelbar auf klimatische Veränderungen. Extreme Wetterbedingungen wie Hitze, Kälte oder hohe Luftfeuchtigkeit setzen der Haut besonders zu und stellen sie vor große Herausforderungen. Vor allem Menschen, die in Regionen mit extremen klimatischen Bedingungen leben oder arbeiten, sind betroffen. Doch auch in der Reisemedizin, bei chronischen Hauterkrankungen oder im arbeitsmedizinischen Kontext rücken klimabedingte Hautreaktionen zunehmend in den Fokus. Die klinische Bedeutung dieses Themas wird unter anderem durch Erkenntnisse aus der Polarforschung unterstrichen. So dokumentierte Dr. Peter Frölich, Allgemeinmediziner und ehemaliger Leiter der Neumayer-Station III, eindrucksvoll, wie kalte, trockene Luft und intensive UV-Strahlung die Hautbarriere stark beanspruchen – eine Erfahrung, die auch für die dermatologische Praxis von Bedeutung ist.
Wie Klima die Hautbarriere beeinflusst
Unterschiedliche Umweltbedingungen können die Balance der Hautbarriere erheblich stören und vielfältige Folgen nach sich ziehen.
In heißen, trockenen Klimazonen steigt der transepidermale Wasserverlust, während die Lipidproduktion abnimmt. Dadurch wird die Haut durchlässiger für irritierende Substanzen, was das Risiko für Reizungen und Barrierestörungen erhöht.
In kalten, windigen Regionen hingegen wird die Durchblutung der Haut verringert. Der Wind übt mechanischen Stress aus, was zu mikroskopisch kleinen Schäden an der Barriere führt. Die Haut wird dadurch anfälliger für Risse, Kälteerytheme und entzündliche Prozesse.
Ein feucht-warmes Klima wiederum fördert – insbesondere bei vermehrtem Schwitzen, erhöhter Talgproduktion und Mazeration – das Wachstum von Mikroorganismen auf der Haut. Dies kann zu verstopften Poren, akneähnlichen Veränderungen und einer erhöhten Anfälligkeit für Pilz- oder bakterielle Infektionen führen.
Individuelle Hautpflege je nach Klima
Die richtige Hautpflege sollte immer an die jeweiligen klimatischen Bedingungen angepasst werden:
In heißen, trockenen Regionen steht die Feuchtigkeitsversorgung im Vordergrund. Ceramidhaltige Emollienzien, Jojobaöl und Sonnenschutz mit mindestens SPF 30 sind empfehlenswert. Die Pflege sollte direkt nach dem Duschen aufgetragen und der UV-Schutz regelmäßig erneuert werden.
Bei Kälte und Wind helfen okklusive Produkte mit Vaseline oder Lanolin sowie Glycerincremes, die Feuchtigkeit binden. Die Schutzpflege wird vor dem Aufenthalt im Freien aufgetragen, abends empfiehlt sich eine rückfettende Pflege.
In feucht-heißem Klima gilt es, Mazeration und Schweißbildung zu kontrollieren. Alkoholfreie, wasserbasierte Reinigungsgele, absorbierende Puder und atmungsaktive Baumwollkleidung unterstützen ein ausgeglichenes Hautklima.
Generell gilt: Je stärker die klimatische Belastung, desto gezielter sollte die Auswahl der Pflegeprodukte erfolgen – abgestimmt auf Hauttyp, Expositionsdauer und individuelle Risiken. Reiz- und Duftstoffe sowie Silikone sollten möglichst gemieden werden.
Klimabedingte Hautprobleme in der Praxis
Die Auswirkungen des Klimas auf die Haut sind längst im Praxisalltag angekommen. Immer mehr Patient:innen berichten über umweltbedingte Hautbeschwerden – sei es in der Dermatologie, Allgemeinmedizin oder Arbeitsmedizin. Besonders relevant zeigt sich dies in drei Bereichen: der Betreuung von Patient:innen mit chronischen Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Psoriasis oder gestörter Hautbarriere, der Beratung in der Reisemedizin, etwa bei Aufenthalten in tropischen, alpinen oder polaren Regionen, sowie der arbeitsmedizinischen Prävention und Betreuung, zum Beispiel für Beschäftigte im Bauwesen, Wintersport oder auf See.
Wie sehr klimatische Extreme die Haut belasten können, zeigt das Beispiel von Frau M., 42, die als Bauleiterin täglich starken Wetterumschwüngen ausgesetzt ist – von sengender Sommerhitze bis zu eisigem Winterwind. Während einer langen Hitzewelle in Süddeutschland wurde ihre Haut an Unterarmen und Gesicht zunehmend trocken und schuppig, begleitet von Juckreiz und Rötungen. Erst der gezielte Wechsel auf eine reichhaltige, ceramidhaltige Pflege und konsequenter UV-Schutz brachte Besserung. Im Winter verschärften kalter Wind und trockene Luft die Beschwerden: Ihre Hände rissen auf, Ekzeme erschwerten den Alltag. Mit okklusiven Salben und schützenden Handschuhen konnte sie die Hautbarriere schließlich stabilisieren und die Symptome lindern.
Fazit
Klimatische Extreme stellen die Haut vor erhebliche Herausforderungen und erfordern individuelle Schutz- und Pflegestrategien – sei es im Alltag, bei chronischen Hauterkrankungen, in der Arbeitsmedizin oder auf Reisen. Die Erfahrungen aus der Polarforschung und der klinischen Praxis verdeutlichen, wie sensibel die Haut auf Hitze, Kälte und Feuchtigkeit reagiert und wie wichtig es ist, Prävention und Pflege gezielt an Klima, Hauttyp und Expositionsdauer anzupassen. Angesichts der wachsenden Bedeutung klimabedingter Hautprobleme rücken maßgeschneiderte Präventionskonzepte und interdisziplinärer Austausch, wie beim Kongress „Spektrum Hautgesundheit 2025: Haut am Limit. Unser Integument im (Klima-)Wandel“, immer stärker in den Fokus der modernen Dermatologie.
Quellen:
Harvard Medicine Magazine: How a Warming Climate Wears on the Skin. 2024. https://magazine.hms.harvard.edu/articles/how-warming-climate-wears-skin (abgerufen am 07.07.2025)
Alfred-Wegener-Institut: Neumayer-Station III. https://www.awi.de/flotte-stationen/stationen/neumayer-station-iii.html (abgerufen am 07.07.2025)
Anderska, Agnieszka et al. „The impact of climate changes on skin diseases: A narrative review of the literature.“ Przeglad Epidemiologiczny, 2024, https://doi.org/10.32394/pe/199739.
Sharma, Divya „Insights on the Intersection of Climate Change, Air Pollution, and Dermatology at the AAD 2025 Annual Meeting.“ Dermatology The American Medical Journal, 2025, https://doi.org/10.33590/dermatolamj/VADV4402.

Depressionen bei Männern zeigen sich oft nicht durch Traurigkeit, sondern durch Aggression und Rückzug. Doch wie erkennt man die atypischen Symptome, und welche Folgen hat das Verkennen dieser Erkrankung für Betroffene und ihr Umfeld?
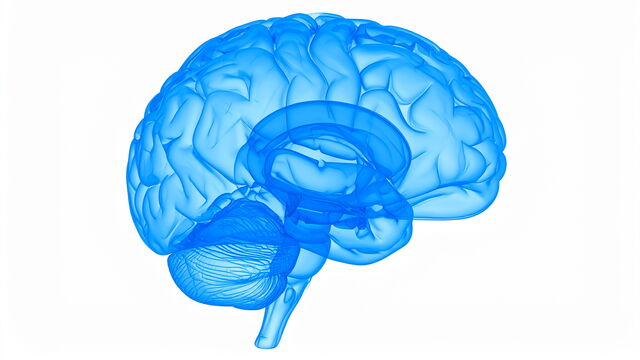
Der Kongress der Dt. Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN) 2025 in Frankfurt stand ganz im Zeichen von Innovativen Technologien und Lebenslangen Lernen. Über 2.000 Teilnehmer aus Forschung, Klinik und Industrie diskutierten vom 12. bis 14. März wegweisende Ansätze, die die Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen revolutionieren.


