Filterblasen und Co.: Social Media als Beschleuniger depressiver Symptome

Die fortschreitende Digitalisierung prägt den Alltag von Jugendlichen und Erwachsenen zunehmend. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen ziehen eine Verbindung zwischen intensiver Nutzung sozialer Medien und dem gehäuften Auftreten von depressiven Symptomen. Obwohl eine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung bislang nicht abschließend belegt werden konnte, offenbaren sich zentrale Faktoren, die das psychische Wohlbefinden beeinträchtigen können.
Zeitaufwand im Netz: Ein Risikofaktor für die psychische Verfassung?
Mehrere Studien belegen, dass eine längere Verweildauer auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder Facebook mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für depressive Symptome einhergeht. Zu den psychisch belastenden Aspekten zählen vor allem Empfindungen von sozialer Isolation infolge von Ablehnungserfahrungen, zunehmende Einsamkeit durch den Ersatz echter Kontakte durch virtuelle, sowie die weit verbreitete Problematik des Cybermobbings.
Ein sozialpsychologisches Phänomen stellt der Vergleich mit Anderen dar, verstärkt durch algorithmisch generierte Filterblasen: Personen mit einer negativen Grundstimmung werden durch personalisierte Inhalte zunehmend in einer Art Echokammer gefangen, die depressive Tendenzen fördern kann.
Algorithmen als Verstärker problematischer Inhalte
Die schnelle Einbettung in psychisch belastende Filterblasen verdeutlicht ein Experiment von BR Data und PULS Reportage. Journalistische Recherchen simulierten das Konsumverhalten von Nutzer:innen, die sich auf TikTok gezielt mit Themen wie Depressionen, Selbstverletzungen und Suizidgedanken auseinandersetzen. Bereits nach etwa 150 angesehenen Videos, was einer halbstündigen Nutzung entspricht, wurde der persönliche Feed nahezu ausschließlich von solchen Inhalten dominiert.
Hinzu kommt, dass psychische Erkrankungen ästhetisiert dargestellt werden können, wodurch ein verzerrtes Bild entsteht, das Symptome als attraktiv oder erstrebenswert interpretiert. Dieses Phänomen ist beispielsweise auch bei Essstörungen und selbstverletzendem Verhalten dokumentiert.
Problematische Trends und ihre Wirkung auf Betroffene
Insbesondere gefährliche Strömungen auf Social Media verstärken die Risiken:
- Essstörungen: Unter Hashtags wie "Pro-Ana" und "Pro-Mia" finden sich Inhalte, die Magersucht und Bulimie als Lifestyle feiern, inklusive Hungerwettbewerben und Gemeinschaftsbildern mit Betroffenen, oft gepaart mit Selbstverletzung und Suizidmotiven.
- Selbstverletzendes Verhalten: Die Darstellung und Verharmlosung selbstschädigender Verhaltensweisen fördern potenzielle Trigger.
- Herausforderungen (Challenges): Manche viralen Challenges fördern riskantes, gesundheitsschädigendes Verhalten und können in Krisensituationen zur Destabilisierung beitragen.
- Pseudo-Tourette: Populäre Videos mit Tourette-ähnlichen Symptomen haben zu einer Zunahme vermeintlicher Fälle geführt, teilweise mit Fehldiagnosen und einer Art Massenphänomen.
Soziale Medien als Raum für Aufklärung und Gemeinschaft
Auf der positiven Seite schaffen soziale Medien niedrigschwellige Zugänge zu Informationen und Austauschmöglichkeiten. Sie bieten insbesondere jenen, die unter stigmatisierten Erkrankungen leiden, Anonymität und Zugang zu unterstützenden Peer-Gruppen. Dies hilft, das Gefühl von Isolation zu überwinden und kann die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen fördern. Trotzdem warnen Fachorganisationen wie die Deutsche Depressionsliga vor unseriösen Influencern, die Erkrankungen verharmlosen oder für kommerzielle Zwecke instrumentalisieren.
Empfehlungen für den Umgang mit Social Media im Kontext psychischer Gesundheit
Im therapeutischen und beratenden Umgang mit psychischer Gesundheit bei der Nutzung sozialer Medien ist es ratsam, Patient:innen vertrauenswürdige und renommierte Kanäle von Organisationen zu empfehlen, die kompetente und seriöse Informationen bereitstellen. Dazu zählen unter anderem die Deutsche Depressionsliga (@depressionsliga), die Deutsche Depressionshilfe (@stark_gegen_depression) sowie die Robert Enke Stiftung (@enkestiftung). Solche Quellen bieten fundierte Aufklärung und unterstützen Betroffene durch verlässliche Informationen.
Wichtig ist dabei, dass die als seriös eingestuften Inhalte keine unrealistischen Heilversprechen enthalten und die Depression klar als ernsthafte Erkrankung abgegrenzt wird. Ebenso sind ein sensibler Umgang mit Sprache und Bildmaterial entscheidend, um eine moralische Bewertung oder Verharmlosung der Erkrankung zu vermeiden. Diese Kriterien helfen dabei, die Qualität der Informationen einzuschätzen und Patient:innen vor irreführenden oder schädlichen Inhalten zu schützen. So wird ein verantwortungsvoller und unterstützender Umgang mit dem Thema psychische Gesundheit im Kontext sozialer Medien gefördert.
Quellen:
Primack, B.A. et al. (2021): Temporal Associations Between Social Media Use and Depression Among Young Adults. American Journal of Preventive Medicine. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2020.09.014.
Boers, E. et al. (2019): Associations Between Screen Time and Depression in Adolescence. JAMA Pediatrics. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2019.1759.
Perlis, R.H. et al. (2021): Association Between Social Media Use and Self-reported Symptoms of Depression in US Adults. JAMA Network Open. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.36113
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression. 2022. Registernummer: nvl-005. Version 3.2. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005 (abgerufen am 30.09.2025).
Springer Medizin: Depression & soziale Medien: Mit diesen 3 Fakten sind Sie up to date. 2023. https://www.springermedizin.de/depression---soziale-medien--/25371132 (abgerufen am 11.10.2025).

Allergische Rhinitis ist keine Bagatelle: Für viele Kinder und Jugendliche bedeutet sie chronisches Leiden und erhöht das Risiko für Asthma. Neue Ansätze in Diagnostik und Therapie versprechen nachhaltige Entlastung.

In einer Welt der Produktivität und unermüdlichen Erfolgen gelten Olympioniken, CEOs und Nobelpreisträger als Sinnbilder menschlicher Möglichkeiten. Doch dahinter verbirgt sich eine leise Wahrheit: psychische Krisen. Als Simone Biles 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio ihren Rücktritt erklärte, um auf Verstand und Körper zu hören, löste dies eine Debatte aus und offenbarte ein neurobiologisches Faktum: Höchstleistungen sind untrennbar mit psychischer Widerstandsfähigkeit verknüpft.
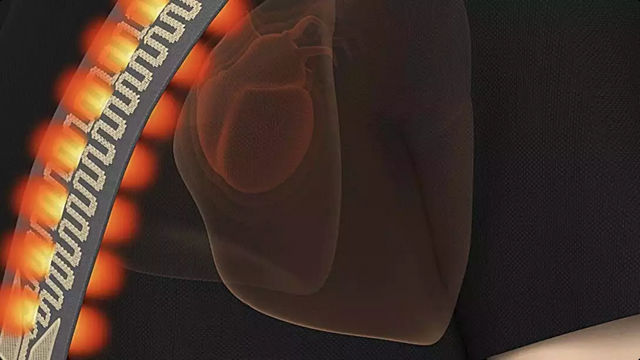
Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kann die Crew im Cockpit unvorhersehbaren Belastungen ausgesetzt sein. Um solche Situationen mit Überforderung frühzeitig zu erkennen, testete die Technische Universität Braunschweig im Forschungsschwerpunkt Mobilität Geräte zum Piloten-Monitoring in realen Verkehrsflugzeugen. Gefördert wurde das Vorhaben von „Clean Sky 2 Joint Undertaking“.

