Laserbehandlung von Café-au-Lait-Flecken: Welche Merkmale den Erfolg beeinflussen

Café-au-Lait-Flecken (CALMs) sind gutartige Pigmentstörungen, die bei etwa 15 % der Allgemeinbevölkerung und 2 % der Neugeborenen auftreten. Diese braunen Flecken können verschiedene Größen und Formen annehmen und zeigen sich meist an sonnenexponierten Körperstellen. Häufig sind sie harmlos, doch wenn sie an prominenten Stellen wie im Gesicht erscheinen, können sie das soziale Leben und das Selbstbewusstsein der betroffenen Patient:innen stark beeinträchtigen. Eine Behandlung ist daher oft aus kosmetischen Gründen gefragt. Doch welche Merkmale beeinflussen den Erfolg der Laserbehandlung?
Der Unterschied zwischen segmentalen und nicht-segmentalen CALMs
Während die genauen Ursachen für das Auftreten von CALMs noch nicht abschließend geklärt sind, gibt es Hinweise, dass die Morphologie und die Verteilungsmuster der Flecken eine Rolle für die Behandlungsergebnisse spielen. Die Flecken können in verschiedenen Formen auftreten: Von regelmäßigen, glatten Rändern bis hin zu unregelmäßig gezackten Formen. Die Verteilung kann isoliert oder segmental erfolgen, was möglicherweise auf die Entwicklung der Melanozyten aus der Neuralleiste hinweist. Interessanterweise scheint die morphologische Beschaffenheit einen erheblichen Einfluss auf den Behandlungserfolg zu haben – und dies ist ein Punkt, den die Forschung genauer untersucht.
Lasertherapie als bevorzugte Behandlungsoption
Die traditionelle Behandlung von CALMs wie Kryotherapie oder Elektrofulguration birgt das Risiko von Narbenbildung und Dyspigmentierung. Daher greifen immer mehr Mediziner:innen zu Laserverfahren, die auf der selektiven Photothermolyse basieren. Besonders der 755-nm-Alexandritlaser hat sich als vielversprechend erwiesen, da er eine effektive Behandlung mit minimalen Nebenwirkungen ermöglicht. Ein weiterer vielversprechender Kandidat ist der Pikosekundenlaser, der aufgrund seiner kurzen Pulsdauer und starken photomechanischen Effekte ebenfalls gute Ergebnisse bei der Behandlung von Pigmentstörungen zeigt. Trotz dieser Fortschritte war es bisher schwierig, fundierte Vergleiche zwischen Pikosekunden- und Nanosekundenlasern zu finden.
Bessere Ergebnisse bei segmentalen und unregelmäßigen CALMs
Eine retrospektive Analyse von 319 Patient:innen, die zwischen 2015 und 2022 mit einem 755-nm-Alexandritlaser behandelt wurden, liefert spannende Einblicke: Fast Dreiviertel der Patient:innen mit segmentalen CALMs zeigten eine deutliche Besserung (Verbesserung von Schweregrad 2–4), während dies bei nicht-segmentalen CALMs nur bei etwas über Hälfte der Fall war. Noch deutlicher war der Unterschied bei der Randstruktur: Läsionen mit unregelmäßigen Rändern erzielten signifikant bessere Ergebnisse als solche mit glatten, regelmäßigen Rändern.
Fall 1: Segmentale Läsion mit starkem Therapieerfolg
Eine jugendliche Patientin stellte sich mit einem segmentalen, großflächigen Café-au-Lait-Fleck im Gesicht vor. Die Läsion bestand seit dem Säuglingsalter. Nach nur einer Behandlung mit einem Pikosekundenlaser (755 nm) zeigte sich nach drei Monaten eine nahezu vollständige Abblassung. Die Patientin war mit dem kosmetischen Ergebnis hochzufrieden und benötigte keine weitere Sitzung.
Fall 2: Nicht-segmentale Läsion mit begrenzter Wirkung
Ein anderer Fall betraf eine Patientin mit nicht-segmentalen CALMs mit glatten Rändern im Wangenbereich. Nach zwei Behandlungen mit dem Pikosekundenlaser war nach sechs Monaten nur eine geringe Besserung sichtbar. Trotz sorgfältiger Laserauswahl blieb der Therapieerfolg limitiert – ein Hinweis darauf, wie wichtig die Morphologie für die Prognose ist.
Lasertechnik allein reicht nicht: Rückfälle und Nebenwirkungen
Interessanterweise hatte weder das Alter der Patient:innen noch das Alter der CALMs einen signifikanten Einfluss auf das Behandlungsergebnis. Auch zwischen den Lasertechnologien, dem 755-nm-Alexandrit-Pikosekundenlaser und dem Q-switched 755-nm-Alexandritlaser, wurden keine großen Unterschiede in der Wirksamkeit festgestellt. Jedoch war die Zahl der Behandlungen mit Nebenwirkungen wie Hypopigmentierung und postinflammatorischer Hyperpigmentierung korreliert. Diese traten jedoch in ähnlicher Häufigkeit auf, unabhängig vom verwendeten Lasertyp. Ein weiterer wichtiger Punkt: Trotz der erfolgreichen Behandlung zeigten fast 17 % der Patient:innen in der Nachbeobachtungszeit von sechs Monaten Rückfälle.
Fazit – Individualisierung ist der Schlüssel
Die Studienergebnisse zeigen: Segmentale CALMs und solche mit unregelmäßigen Rändern sprechen signifikant besser auf Lasertherapie an. Das Alter der Patient:innen oder Flecken scheint hingegen kaum Einfluss zu haben. Für Ärzt:innen bedeutet das: Eine sorgfältige Analyse der Fleckenmorphologie ist entscheidend. Die Wahl der Lasertechnologie sollte individuell getroffen werden – in enger Abstimmung mit den ästhetischen Erwartungen der Patient:innen. So lässt sich der Behandlungserfolg langfristig sichern und das Rückfallrisiko minimieren.
Quellen:
Liu et al. (2025): Characteristics of Skin Lesions Determine the Therapeutic Response of Facial Café Au Lait Macules Laser Therapy. Journal of Cosmetic Dermatology, DOI: 10.1111/jocd.70062.

Hautmanifestationen bei chronischer Nierenerkrankung werden häufig unterschätzt – dabei leiden fast alle Patient:innen mit terminalem Nierenversagen an Pruritus, Xerosis & Co. Doch was bedeutet das für die Praxis? Lesen Sie, warum ein interdisziplinärer Ansatz in der CKD-Therapie zunehmend unverzichtbar wird.

Antidepressiva wirken meist ähnlich stark – doch ihre Nebenwirkungen unterscheiden sie deutlich. Manche Effekte können sogar nützlich sein, wenn sie gezielt genutzt werden.
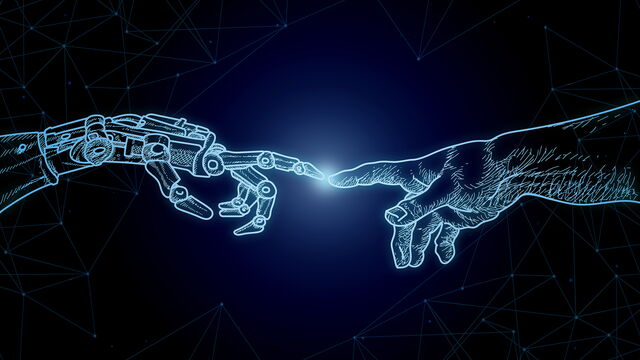
Checkpoint-Inhibitoren haben das Überleben von Patient:innen mit malignem Melanom verbessert. Doch nicht alle profitieren – viele kämpfen mit teils gravierenden Nebenwirkungen. KI könnte durch frühzeitige Vorhersage von Therapieansprechen und Nebenwirkungen durch Deep Learning völlig neue Wege zur personalisierten Immuntherapie eröffnen.

