Innovative Technologien und lebenslanges Lernen: Die Zukunft der klinischen Neurowissenschaften
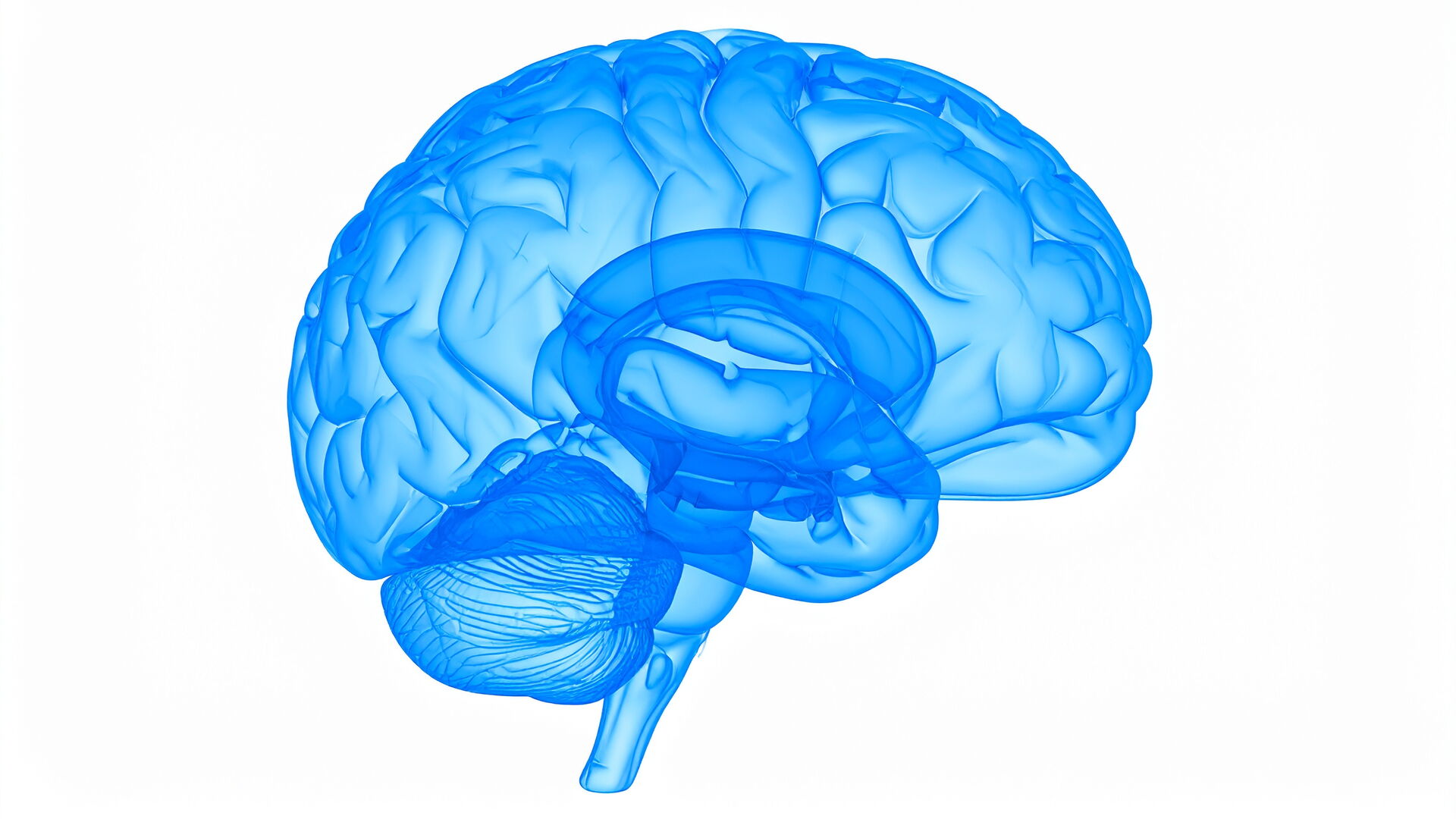
Innovative Technologien – Vom Labor in die Praxis
1. KI-gestützte Diagnostik: Epilepsie-Prognose in Echtzeit
Ein Highlight des Kongresses war die Vorstellung einer KI-basierten Plattform zur Vorhersage epileptischer Anfälle, entwickelt vom Frankfurter Startup NeuroPredict. In einer Fallstudie berichtete Prof. Dr. Lena Hofmann (Universitätsklinikum Frankfurt) von einer 24-jährigen Patientin mit therapieresistenter Epilepsie, deren Anfälle mithilfe eines implantierbaren Sensorsystems und eines Algorithmus zu 89 % präzise vorhergesagt wurden. „Die KI analysiert kontinuierlich EEG-Daten und leitet bei Risiko eine Warnung an die Patientin sowie ihren Arzt weiter“, so Hofmann. In der anschließenden Studie mit 150 Probanden reduzierte sich die Anfallshäufigkeit durch rechtzeitige Medikamentenanpassung um 42 %.
Kritisch diskutiert wurde jedoch die Frage der Datensicherheit. Dr. Markus Vogel (Ethikrat Berlin) warnte: „Die Sensitivität neurophysiologischer Daten erfordert höchste Schutzstandards – hier besteht noch regulatorischer Nachholbedarf.“
Neuroprothetik: Gehen nach Querschnittslähmung
Sensationsfaktor hatte die Präsentation des WalkAgain-Projekts, einer Kooperation der TU München und des MIT. Ein 33-jähriger Patient mit kompletter Querschnittslähmung konnte nach Implantation eines Rückenmark-Stimulators und eines exoskelettgestützten Trainingssystems erstmals wieder selbstständig Schritte machen. „Durch Kombination von Hirn-Computer-Schnittstellen und robotergestützter Physiotherapie aktivierten wir spinale Mustergeneratoren, die gangähnliche Bewegungen ermöglichen“, erklärte Projektleiter Prof. Dr. Julian Weber. Die Ergebnisse, publiziert in Nature Neuroscience, zeigen: Nach zwölf Monaten Training verbesserte sich nicht nur die Motorik, sondern auch die Blasenkontrolle – ein bisher kaum erforschter Nebeneffekt.
Hochauflösende Bildgebung: Mikrostrukturen des Gehirns sichtbar machen
Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Sarah Braun (Charité Berlin) präsentierte ein neues 7-Tesla-MRT-Verfahren, das die Darstellung von Amyloid-Plaques bei Alzheimer-Patienten um das Dreifache präzisiert. In einer Vergleichsstudie mit 200 Probanden ermöglichte die Technologie eine Diagnose im Frühstadium mit 95 % Spezifität – ein Durchbruch für die personalisierte Therapieplanung. „Je früher wir eingreifen, desto eher können wir kognitive Abbauprozesse verlangsamen“, betonte Braun.
2. Lebenslanges Lernen – Kompetenzen für die Praxis von morgen
Virtual Reality: OP-Simulationen für Neurochirurgen
Wie lassen sich komplexe Eingriffe wie Tiefenhirnstimulationen risikofrei trainieren? Die Antwort lieferte das Projekt NeuroSimVR der DGKN-Akademie. In einem Workshop testeten Teilnehmer eine VR-Umgebung, die reale OP-Szenarien detailgetreu abbildet – inklusive haptischem Feedback. „Die Fehlerquote bei Anfängern sank nach fünf Simulationen um 70 %“, resümierte Dr. Felix Maurer (LMU München). Besonders überzeugte die Möglichkeit, seltene Komplikationen wie Gefäßrupturen gezielt zu üben.
Digitale Lernplattformen: Wissen on-demand
Dr. Emilia Klein (DGKN-Vorstand) stellte die neue App NeuroFlow vor, die Kurse zu Neuromodulation, KI-Grundlagen und Ethik bündelt. Ein Pilotprojekt mit 300 Neurologen zeigte: Nutzer, die monatlich mindestens zwei Microlearning-Einheiten absolvierten, steigerten ihre Diagnosegenauigkeit bei Parkinson-Symptomen um 25 %. „Lebenslanges Lernen darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Es muss in den klinischen Alltag integrierbar sein“, forderte Klein.
Interdisziplinäre Netzwerke: Vom Labor zum Patientenbett
In einer Podiumsdiskussion betonten Experten wie Prof. Dr. Thomas Wagner (Max-Planck-Institut) die Bedeutung von Austauschformaten zwischen Grundlagenforschung und Klinik. Beispielhaft hierfür: das Neuro-Innovation-Hub-Programm, das Ärzte und Ingenieure in gemeinsamen Projekten wie der Entwicklung tragbarer EEG-Headsets zusammenbringt. „Nur durch interdisziplinäre Teams können wir translationale Medizin vorantreiben“, so Wagner.
Kontroversen und Zukunftsfragen
Trotz der Euphorie warnten Stimmen wie die des Neurologen Dr. Christoph Berger vor einer „Technologiegläubigkeit“: „Nicht jedes Gadget hilft Patienten. Wir müssen klare Prioritäten setzen – sonst verspielen wir Ressourcen und Vertrauen.“ Auch die Frage, wer Zugang zu Hightech-Therapien erhält, blieb offen. Dr. Aisha Al-Mansoori (WHO) mahnte: „Innovationen dürfen nicht nur Privatkliniken vorbehalten sein. Wir brauchen globale Partnerschaften für gerechte Verteilung.“
Fazit: Eine Ära der Möglichkeiten – mit Verantwortung
Der DGKN-Kongress 2025 machte deutlich: Die klinischen Neurowissenschaften stehen an einem Wendepunkt. Künstliche Intelligenz, Neuroprothetik und immersive Lernformate eröffnen ungeahnte Chancen – doch ihr Erfolg hängt davon ab, ob Fachkräfte sie sicher und reflektiert einsetzen. Wie Prof. Dr. Hofmann abschließend betonte: „Technologie ist kein Selbstzweck. Ihr Wert misst sich daran, ob sie Leben verbessert – und ob wir bereit sind, gemeinsam zu lernen, sie verantwortungsvoll zu nutzen.“
Quellen:
Sowie Kongressabstracts, Pressematerialien des DGKN und Interviews mit Teilnehmern, anonymisierten Fallstudien und Expertenmeinungen.

Die schädlichen Auswirkungen von UV-Strahlung auf die Haut sind gut dokumentiert und stellen eine der Hauptursachen für vorzeitige Hautalterung dar.

Kleine Proben, große Wirkung: Warum dermatologische Produktproben Klima und Ressourcen stärker belasten als gedacht – und wie ein Umdenken in Praxen und Industrie beginnt.


